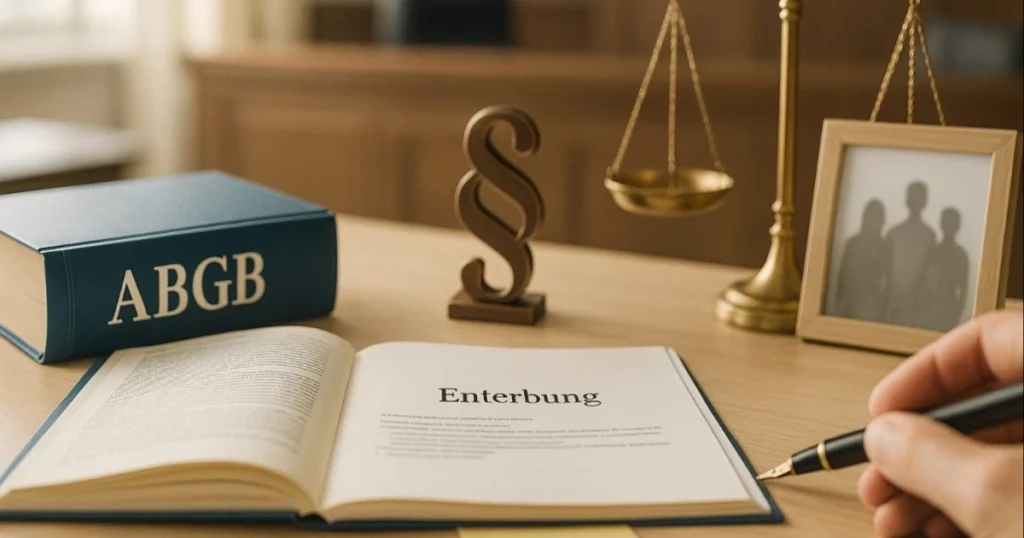Ein Enterbungsgrund im Sinne der relativen Erbunwürdigkeit kann zum Beispiel eine schwere Verfehlung gegenüber dem oder der Verstorbenen oder dessen/deren nahen Angehörigen sein. Dabei muss die betreffende Person vorsätzlich – also absichtlich – eine gerichtlich strafbare Handlung begangen haben, die mit mehr als einem Jahr Freiheitsstrafe bedroht ist.
Diese Straftat muss sich gegen:
- den oder die Verstorbene:n selbst,
- dessen/deren Ehegatt:in, eingetragenen Partner:in oder Lebensgefährt:in
- oder dessen/deren Verwandte in gerader Linie (z. Kinder, Eltern, Enkel) gerichtet haben.
OGH 2 Ob 200/23k: In diesem Urteil wird die relative Erbunwürdigkeit zwar thematisiert, jedoch nicht bejaht, weil die begangene Tat nicht mit einer Freiheitsstrafe von mehr als einem Jahr bedroht war und daher nicht unter § 541 Z 1 ABGB fällt.
Ein weiterer Grund für relative Erbunwürdigkeit ist, wenn eine Person dem oder der Verstorbenen in besonders verwerflicher Weise schweres seelisches Leid zugefügt hat.
OGH 2 Ob 228/23b: Hier wurde eine Enterbung wegen schwerer seelischer Misshandlung als gerechtfertigt anerkannt. Das Verhalten der Töchter gegenüber ihrer Mutter erfüllte den Tatbestand des § 541 Z 2 ABGB.
Auch eine grobe Vernachlässigung familiärer Pflichten kann zur relativen Erbunwürdigkeit führen.
Das betrifft etwa Fälle, in denen ein Elternteil das Kind (den oder die Verstorbene:n) stark vernachlässigt oder missbräuchlich behandelt hat. Ebenso kann ein Kind durch schwerwiegendes Fehlverhalten gegenüber seinen Eltern erbunwürdig werden.
Gemäß § 42 ABGB gelten als „Eltern“ alle Verwandten in gerader aufsteigender Linie (z. B. Eltern, Großeltern), und als „Kinder“ alle Verwandten in absteigender Linie (z. B. Kinder, Enkel).
OGH 2 Ob 219/23d: Das Urteil zeigt, dass eine grobe Pflichtverletzung nachgewiesen werden muss. Bloße Kontaktlosigkeit oder familiäre Konflikte reichen nicht automatisch aus.
Damit eine Enterbung aufgrund relativer Erbunwürdigkeit wirksam ist, müssen zusätzlich bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein:
Der oder die Verstorbene muss an der Enterbung gehindert gewesen sein, obwohl er/sie sie wohl vorgenommen hätte. Dies ist etwa der Fall, wenn der oder die Verstorbene testierunfähig war (z. B. wegen Demenz), von der Tat nichts wusste oder aus anderen Gründen keine wirksame Enterbung vornehmen konnte.
Es darf keine Verzeihung seitens des oder der Verstorbenen erfolgt sein. Eine solche Verzeihung kann sich zum Beispiel aus einem Brief, einer späteren Versöhnung oder weiteren Zuwendungen ergeben, die auf eine bewusste Verzeihung schließen lassen.
Sie haben noch Fragen? Rechtsanwalt Mag. Hanns D. Hügel unterstützt Sie gerne bei allen Arbeitsrechtlichen, Erbrechtlichen, Wirtschaftsrechtlichen, Medienrechtlichen und Mietrechtlichen Fragen. Einen Termin — egal ob vor Ort in Mödling oder online – können sie gleich hier vereinbaren.
Hinweis: Dieser Beitrag wurde sorgfältig ausgearbeitet und dient zu allgemeinen Informationszwecken. Der Beitrag ersetzt keinesfalls eine individuelle Rechtsberatung und stellt keine Rechtsauskunft dar. Wir übernehmen daher keinerlei Haftung für die angebotenen Informationen und Beiträge, wie insbesondere für deren Richtigkeit, Aktualität und Fehlerfreiheit. Bitte beachten Sie, dass sich die Rechtslage ändern kann und wir unsere Beiträge nicht regelmäßig aktualisieren.