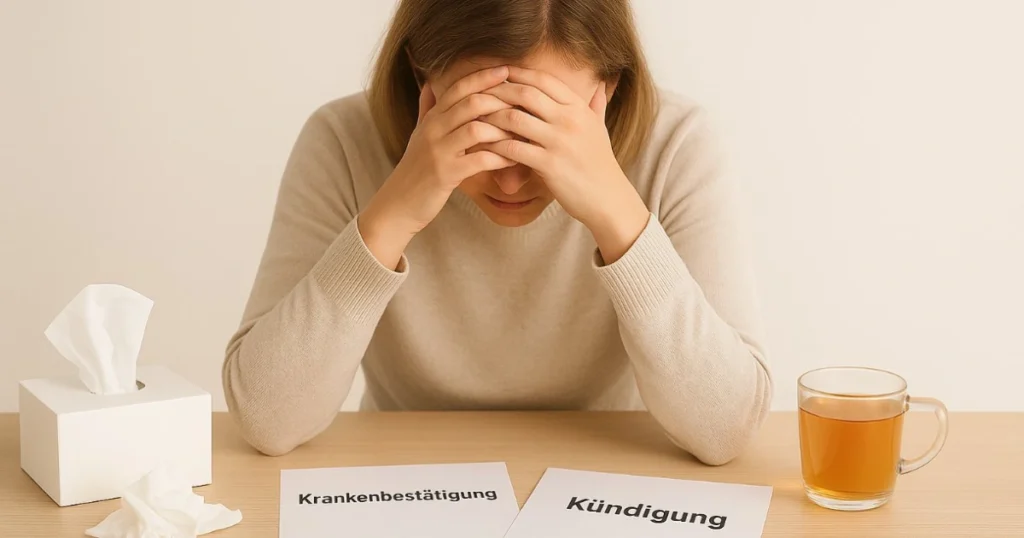Kündigung im Krankenstand
Eine Dienstverhinderung aufgrund von Krankheit oder eines Unglücksfalls berührt eine Kündigung grundsätzlich nicht. Es ist aber zu unterscheiden, ob die Dienstverhinderung vor oder nach Ausspruch der Kündigung eingetreten ist. Das hat wesentliche Bedeutung für die Fortzahlung des Krankenentgelts.
Entgeltfortzahlung bei Kündigung im Krankenstand
Der Entgeltfortzahlungsanspruch während einer Dienstverhinderung ist für Angestellte im Angestelltengesetz (AngG) geregelt und für Arbeiter:innen im Entgeltfortzahlungsgesetz (EFZG) bzw. teilweise im Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch (ABGB) geregelt. Es macht für die Beendigung eines Arbeitsverhältnisses keinen Unterschied, ob die Arbeitnehmer:in im Zeitpunkt der Beendigungserklärung oder im Zeitpunkt des tatsächlichen Endes des Arbeitsverhältnisses arbeitsunfähig erkrankt ist. Der Entgeltanspruch endet mit dem letzten Tag des Arbeitsverhältnisses (§ 9 Abs 3 AngG).
Wenn das Arbeitsverhältnis während des Krankenstands aber durch die Arbeitgeber:in beendet wird, dann läuft der Entgeltanspruch ausnahmsweise weiter (§ 9 Abs 1 AngG bzw § 5 EFZG; OGH 9 Ob A396/97v). Auch bei Entlassung wegen der durch Erkrankung oder Unglücksfall verursachten Dienstverhinderung wird bei Angestellten der Entgeltanspruch verlängert. Wurde die Kündigung vor Beginn der Erkrankung ausgesprochen oder eine gekündigte Arbeitnehmer:in tritt wieder den Dienst an und erkrankt dann erneut, dann besteht keine Pflicht zur Entgeltfortzahlung über das Ende des Arbeitsverhältnisses hinaus.
Wie lange ist das Krankenentgelt fortzuzahlen?
Wird die Kündigung durch die Arbeitgeber:in vor dem Krankenstand bzw. während dem Krankenstand von der Arbeitnehmer:in ausgesprochen, dann erlischt der Entgeltfortzahlungsanspruch mit dem Enden des Arbeitsverhältnisses, auch wenn die Dienstverhinderung danach weiterhin andauert. Für den Fall der Kündigung durch die Arbeitgeber:in, während die Arbeitnehmer:in im Krankenstand ist, gilt, dass der Anspruch auf Entgeltfortzahlung für die gesetzliche Dauer besteht. Das bedeutet, entweder bis die Arbeitnehmer:in gesund ist oder bis der gesetzliche Entgeltfortzahlungsanspruch erschöpft ist.
Bei der Berechnung des Entgeltfortzahlungsanspruches wird auf das Arbeitsjahr abgestellt, das heißt wenn ein neues Arbeitsjahr beginnt, dann entsteht grundsätzlich ein neuer Entgeltfortzahlungsanspruch. Im Falle einer Kündigung durch die Arbeitgeber:in vor Beginn des neuen Arbeitsjahres bleibt der erkrankten Arbeitnehmer:in der volle Entgeltanspruch bis zu seiner Erschöpfung erhalten, wenn er nach Beginn des neuen Arbeitsjahres immer noch im Krankenstand ist. Im Umkehrschluss heißt das, dass der Entgeltanspruch nicht mit dem (fiktiven) Ende seines letzten Arbeitsjahres endet (OGH 9 Ob A54/24t).
Der gesetzliche Anspruch zur Entgeltfortzahlung im Falle einer Dienstverhinderung ist für Angestellte in § 8 AngG bzw für Arbeiter:innen in § 2 EFZG geregelt, wobei für beide gleichlautendes gilt. Der Anspruch ist von der Anzahl der im Betrieb zurückgelegten Dienstjahre abhängig. In folgender Tabelle ist abgebildet, wie lange der volle bzw. halbe Entgeltfortzahlungsanspruch gesetzlich bestehen kann:
| Dauer des AV | Volles Entgelt | Halbes Entgelt |
| Bis zur Vollendung des 1. Dienstjahres | 6 Wochen | Weitere 4 Wochen |
| 2. bis 15. Dienstjahr | 8 Wochen | Weitere 4 Wochen |
| 15. bis 25. Dienstjahr | 10 Wochen | Weitere 4 Wochen |
| Ab Vollendung des 25. Dienstjahres | 12 Wochen | Weitere 4 Wochen |
Der Arbeitnehmer:in steht im Falle des vollen Entgelts das zu, was er ohne die Dienstverhinderung verdient hätte. Dasselbe gilt auch für den Anspruch auf das halbe Entgelt.
Sie haben noch Fragen? Rechtsanwalt Mag. Hanns D. Hügel unterstützt Sie gerne bei allen Arbeitsrechtlichen, Erbrechtlichen, Wirtschaftsrechtlichen, Medienrechtlichen und Mietrechtlichen Fragen. Einen Termin — egal ob vor Ort in Mödling oder online – können sie gleich hier vereinbaren.
Hinweis: Dieser Beitrag wurde sorgfältig ausgearbeitet und dient zu allgemeinen Informationszwecken. Der Beitrag ersetzt keinesfalls eine individuelle Rechtsberatung und stellt keine Rechtsauskunft dar. Wir übernehmen daher keinerlei Haftung für die angebotenen Informationen und Beiträge, wie insbesondere für deren Richtigkeit, Aktualität und Fehlerfreiheit. Bitte beachten Sie, dass sich die Rechtslage ändern kann und wir unsere Beiträge nicht regelmäßig aktualisieren.