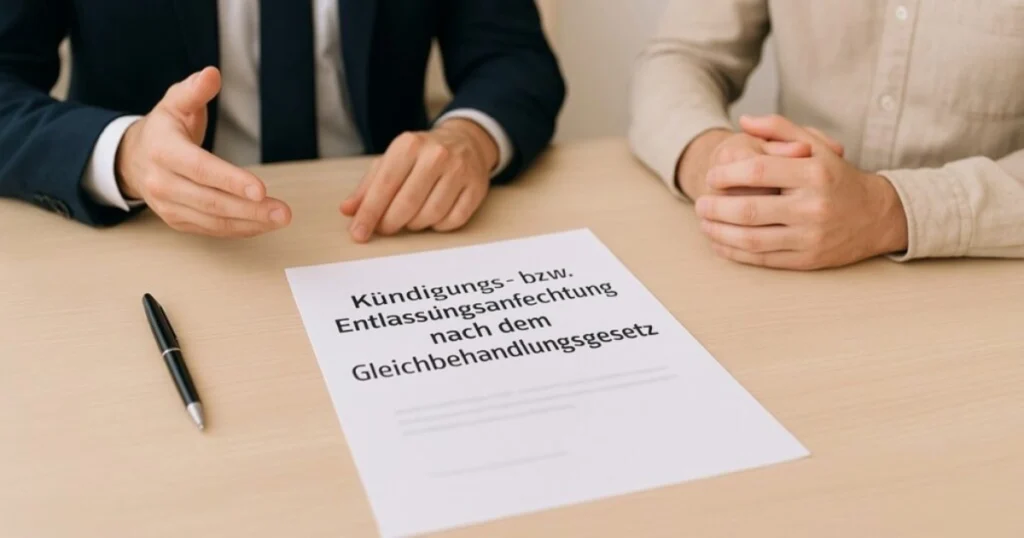Diskriminierung im Sinne des GlBG
Im Gleichbehandlungsgesetz (GlBG) gibt es verschiedene Diskriminierungsgründe, vor denen das Gesetz Arbeitnehmer:innen schützt. Dazu gehören Folgende: Geschlecht, ethnische Zugehörigkeit, Religion oder Weltanschauung, Alter und sexuelle Orientierung. Aufgrund eines dieser Merkmale darf kein Arbeitsverhältnis beendet werden (§ 3 Z 7 bzw § 17 Abs 1 Z 7 GlBG).
Es wird zwischen unmittelbarer und mittelbarer Diskriminierung unterschieden. Eine unmittelbare Diskriminierung liegt vor, wenn eine Dienstnehmer:in eine ungünstigere Behandlung erfährt als andere Dienstnehmer:innen in einer vergleichbaren Situation (§ 5 Abs 1 bzw § 19 Abs 1 GlBG). Die mittelbare Diskriminierung ist schwieriger zu erkennen, weil sie vorliegt, wenn eine anscheinend neutrale Regelung zur Benachteiligung einer Arbeitnehmer:in führt, ohne dass eine sachliche Rechtfertigung gegeben ist (§ 5 Abs 2 bzw § 19 Abs 2 GlBG).
Rechtsfolgen bei Kündigung bzw Entlassung nach dem GlBG
Kommt es dazu, dass ein Arbeitsverhältnis aufgrund einer der genannten Diskriminierungsgründe beendet wird, kann diese Kündigung bzw Entlassung gemäß § 12 Abs 7 bzw § 26 Abs 7 GlBG angefochten werden. Wenn die Arbeitnehmer:in die Kündigung bzw Entlassung gegen sich gelten lässt, dann besteht ein Anspruch auf Ersatz des Vermögensschadens und auf eine Entschädigung für die erlittene persönliche Beeinträchtigung (OGH 8 Ob A6/21x).
Anfechtungsfrist und Beweislast
Eine Kündigung oder Entlassung ist binnen vierzehn Tagen ab ihrem Zugang bei Gericht anzufechten (§ 15 Abs 1a bzw § 29 Abs 1a GlBG). Im Falle einer Geltendmachung der Ansprüche auf Ersatz des Vermögensschadens und auf eine Entschädigung für die erlittene persönliche Beeinträchtigung statt der Anfechtung, hat die Arbeitnehmer:in diese innerhalb von sechs Monaten ab Zugang der Kündigung geltend zu machen (§ 26 Abs 7 letzter Satz und § 19 Abs 1a GlBG).
Das GlBG sieht eine Beweiserleichterung zugunsten der Arbeitnehmer:in vor, da diese die Diskriminierung nur glaubhaft machen muss (OGH 9 Ob A144/14p). Das bedeutet, dass die Arbeitnehmer:in die Richter:in nur davon überzeugen muss, dass die Diskriminierung wahrscheinlicher ist als das von der Gegenseite geltend gemachte, angeblich sachliche Motiv.
Kündigungsanfechtung nach dem GlBG – Kündigungsanfechtung nach dem ArbVG
Die Kündigungs- bzw Entlassungsanfechtung nach dem GlBG gehört zur Individualanfechtung und kann somit nur von der betroffenen Arbeitnehmer:in selbst geltend gemacht werden, während die Kündigungsanfechtung gemäß § 105 ArbVG in erster Linie vom Betriebsrat – sollte einer vorhanden sein – angefochten werden kann. Die Kündigungsanfechtung nach dem Gleichbehandlungsgesetz steht, anders als eine Kündigungsanfechtung nach § 105 ArbVG, auch leitenden Angestellten offen.
Sie haben noch Fragen? Rechtsanwalt Mag. Hanns D. Hügel unterstützt Sie gerne bei allen Arbeitsrechtlichen, Erbrechtlichen, Wirtschaftsrechtlichen, Medienrechtlichen und Mietrechtlichen Fragen. Einen Termin — egal ob vor Ort in Mödling oder online – können sie gleich hier vereinbaren.
Hinweis: Dieser Beitrag wurde sorgfältig ausgearbeitet und dient zu allgemeinen Informationszwecken. Der Beitrag ersetzt keinesfalls eine individuelle Rechtsberatung und stellt keine Rechtsauskunft dar. Wir übernehmen daher keinerlei Haftung für die angebotenen Informationen und Beiträge, wie insbesondere für deren Richtigkeit, Aktualität und Fehlerfreiheit. Bitte beachten Sie, dass sich die Rechtslage ändern kann und wir unsere Beiträge nicht regelmäßig aktualisieren.